
Auch wenn man kein Leben entdeckt, findet man etwas
Ein Team unter der Leitung von Forschenden des Instituts für Teilchenphysik und Astrophysik der ETH Zürich untersuchte, welche Erkenntnisse sich aus dem Szenario „kein Leben entdeckt“ bei zukünftigen Exoplaneten-Untersuchungen gewinnen lassen.
Was wäre, wenn die Suche der Menschheit nach Leben auf anderen Planeten keinen Erfolg bringt? Ein Forscherteam unter der Leitung von Dr. Daniel Angerhausen, Physiker in der Exoplaneten- und Habitabilitätsgruppe von Professor Sascha Quanz an der ETH Zürich und Mitglied des SETI-Instituts, ging dieser Frage nach und überlegte, was man über das Leben im Universum lernen könnte, wenn zukünftige Untersuchungen keine Anzeichen von Leben auf anderen Planeten entdecken. Die Studie, die soeben in der Fachzeitschrift The Astronomical Journal veröffentlicht wurde und im Rahmen des Schweizerischen Nationalen Forschungsschwerpunkts externe Seite PlanetS durchgeführt wurde, stützt sich auf eine statistische Analyse, um die Mindestanzahl von Exoplaneten zu ermitteln, die beobachtet werden sollte, um aussagekräftige Antworten über die Häufigkeit potenziell bewohnter Welten zu erhalten.
Die Studie kommt zu dem Schluss, dass die Wissenschaftler, wenn sie 40 bis 80 Exoplaneten untersuchen und ein „perfektes“ Nichtnachweisergebnis erzielen würden, mit Sicherheit davon ausgehen könnten, dass weniger als 20 bis 10 % der ähnlichen Planeten Leben beherbergen. In der Milchstrasse würden diese 10 % etwa 10 Milliarden potenziell bewohnten Planeten entsprechen. Diese Art von Ergebnissen würde es den Forschenden ermöglichen, eine aussagekräftige Obergrenze für das Vorkommen von Leben im Universum festzulegen – eine Schätzung, die bisher unerreichbar war.
Dieses „perfekte“ Nullergebnis hat jedoch einen entscheidenden Haken: Jede Beobachtung ist mit einem gewissen Mass an Unsicherheit behaftet, weshalb es wichtig ist, zu verstehen, wie sich dies auf die Robustheit der aus den Daten gezogenen Schlussfolgerungen auswirkt. Die Unsicherheiten bei einzelnen Exoplanetenbeobachtungen nehmen unterschiedliche Formen an: Die Interpretationsunsicherheit ist mit falsch negativen Ergebnissen verbunden, was bedeuten kann, dass eine Biosignatur übersehen und eine Welt fälschlicherweise als unbewohnt eingestuft wird. Die so genannte Stichprobenunsicherheit führt zu Verzerrungen in den beobachteten Stichproben – zum Beispiel, wenn nicht repräsentative Planeten einbezogen werden, obwohl sie bestimmte vereinbarte Voraussetzungen für das Vorhandensein von Leben nicht erfüllen. «Es geht nicht nur darum, wie viele Planeten wir beobachten – es geht darum, die richtigen Fragen zu stellen und wie sicher wir sein können, dass wir das, wonach wir suchen, sehen oder nicht sehen», sagt Angerhausen. «Wenn wir nicht vorsichtig sind und zu viel Vertrauen in unsere Fähigkeiten haben, Leben zu erkennen, könnte selbst eine große Untersuchung zu irreführenden Ergebnissen führen».
Solche Überlegungen sind für bevorstehende Missionen wie die von der ETH Zürich geleitete internationale Mission externe Seite Large Interferometer for Exoplanets (LIFE) von grosser Bedeutung. Ziel von LIFE ist es, Dutzende von Exoplaneten zu untersuchen, die in Masse, Radius und Temperatur der Erde ähnlich sind, indem ihre Atmosphären auf Anzeichen von Wasser, Sauerstoff und sogar komplexeren Biosignaturen untersucht werden. Laut Angerhausen und seinen Mitarbeitern ist die gute Nachricht, dass die geplante Anzahl von Beobachtungen gross genug sein wird, um aussagekräftige Rückschlüsse auf das Vorhandensein von Leben in der galaktischen Nachbarschaft der Erde zu ziehen. Dennoch wird in der Studie betont, dass selbst fortschrittliche Instrumente eine sorgfältige Berücksichtigung und Quantifizierung von Unsicherheiten und Verzerrungen erfordern, um sicherzustellen, dass die Ergebnisse statistisch aussagekräftig sind. So weisen die Autoren darauf hin, dass spezifische und messbare Fragen wie „Welcher Anteil der Gesteinsplaneten in der bewohnbaren Zone eines Sonnensystems zeigt deutliche Anzeichen von Wasserdampf, Sauerstoff und Methan?“ der Frage „Wie viele Planeten haben Leben?“ vorzuziehen sind.
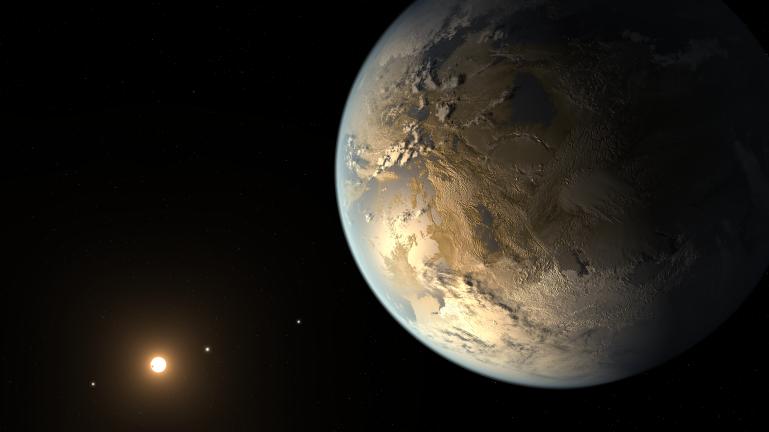
Angerhausen und Kollegen haben auch untersucht, wie sich ein angenommenes Vorwissen – in der Bayes'schen Statistik Prior genannt – über bestimmte Beobachtungsvariablen auf die Ergebnisse künftiger Erhebungen auswirkt. Zu diesem Zweck haben sie die Ergebnisse des Bayes'schen Rahmens mit denen einer anderen Methode verglichen, dem so genannten Frequentistischen Ansatz, der keine Prioritäten vorsieht. Bei der Art von Stichprobengrösse, die bei Missionen wie LIFE angestrebt wird, ist der Einfluss der gewählten Prioritäten auf die Ergebnisse der Bayes'schen Analyse begrenzt: In diesem Szenario liefern die beiden Verfahren vergleichbare Ergebnisse. «In der angewandten Wissenschaft werden die Bayes'sche und die Frequentistische Statistik manchmal als zwei konkurrierende Denkschulen interpretiert. Als Statistikerin betrachte ich sie gerne als alternative und komplementäre Wege, die Welt zu verstehen und Wahrscheinlichkeiten zu interpretieren», sagt Mitautorin Emily Garvin, die derzeit in Quanz' Gruppe promoviert. Garvin konzentrierte sich auf die Frequentisten-Analyse, die dazu beigetragen hat, die Ergebnisse des Teams zu untermauern und ihren Ansatz und ihre Annahmen zu überprüfen. «Geringfügige Unterschiede in den wissenschaftlichen Zielen einer Umfrage können unterschiedliche statistische Methoden erfordern, um eine zuverlässige und präzise Antwort zu geben», erklärt Garvin. «Wir wollten zeigen, wie unterschiedliche Ansätze ein komplementäres Verständnis desselben Datensatzes ermöglichen, und auf diese Weise einen Fahrplan für die Anwendung verschiedener Rahmenwerke aufzeigen».
Diese Arbeit zeigt, warum es so wichtig ist, die richtigen Forschungsfragen zu formulieren, die geeignete Methodik zu wählen und sorgfältige Stichprobenpläne zu erstellen, um eine zuverlässige statistische Auswertung der Ergebnisse einer Studie zu erhalten. «Ein einziger positiver Nachweis würde alles verändern», sagt Angerhausen, «aber selbst wenn wir kein Leben finden, können wir quantifizieren, wie selten – oder häufig – Planeten mit nachweisbaren Biosignaturen tatsächlich sein könnten».
Dieser Text wurde externe Seite der Pressemitteilung des SETI-Instituts entnommen.
Literaturhinweis
Angerhausen, D. et al. What if We Find Nothing? Bayesian Analysis of the Statistical Information of Null Results in Future Exoplanet Habitability and Biosignature Surveys. The Astronomical Journal (2025). externe Seite DOI: 10.3847/1538-3881/adb96d